- Start
- Über Forschen, Stadtentwicklung und Transformation
- 1 | Auf den Schultern von Riesen: das OTSOG-Prinzip
- 2 | Elfenbeinturm? Wissenschaftliche Entwicklung als rationaler Prozess
- 3 | Widerspruch: „Anything goes“
- 4 | Alle forschen: Feyerabend beim Wort genommen?
- 5 | Bücher allein reichen nicht: Aktionsforschung und Co
- 6 | An der Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft:Mode 2-science und Reallabore
- 7 | Stadtentwicklung aus der Praxis für die Praxis?
- 8 | Balance in Spannungsfeldern – auch eine Frage der Haltung
- About the author(s)
- References
Published 31.05.2022
Zwischen Nähe und Distanz
Notizen zum Forschen im Spannungsfeld von Wissenschaft und Praxis
Between Proximity and Distance
Notes on Research in the Tension Field of Science and Practice
Keywords: Wissenschaft; Transformation; Stadtentwicklung; Stadtplanung; science; urban development; urban planning
Abstract:
Theorie und Praxis, Wissenschaft und Gesellschaft… diese Begriffspaare sind häufig zu hören, wenn es um Forschung geht. Sie deuten auf Verbindungen hin, implizieren zugleich Trennendes und lassen so das Bild eines Spannungsfeldes zwischen zwei Polen entstehen. Für Forschung und Forschende ist es wohl unerlässlich, nach ihrem Ort in so einem Feld zu fragen. Dabei gilt es vor allem, das Verhältnis von Nähe und Distanz auszutarieren. Ein gelegentlich heikler Balanceakt. Zumal die Verhältnisse in Bewegung sind. Davon soll hier die Rede sein. Und da die Diskussion zu diesem Thema nicht zum ersten Mal geführt wird ist es vielleicht nützlich, Etappen aus der Vorgeschichte Revue passieren zu lassen. Auf diese Weise werden dann auch einige der Herausforderungen sichtbar, die zu bewältigen sind, wenn transformatives Forschen auf Stadtentwicklung trifft.
Theory and practice, science and society… these pairs of terms are often heard when it comes to research. They suggest connections, but at the same time imply separations and thus create the image of a field of tension between two poles. For research and researchers, it is probably indispensable to ask about their place in such a field. Above all, it is necessary to balance the relationship between proximity and distance. An occasionally delicate balancing act. Especially since the conditions are in flux. That is what we are talking about here. And since this is not the first time the discussion on this topic has been held, it is perhaps useful to review stages from the past. In this way, some of the challenges that have to be overcome when transformative research meets urban development become visible.
Über Forschen, Stadtentwicklung und Transformation
Das Thema dieser pnd-Ausgabe beinhaltet begrifflich drei Ankerpunkte: Forschen, Stadtentwicklung und Transformation. Auf den ersten Blick erscheinen sie selbsterklärend – lohnen aber doch ein erneutes Hinsehen:
Beginnen wir mit dem Forschen. In einem Internet-Wörterbuch lernen wir, dass damit ganz allgemein die aufmerksame Beobachtung von jemanden oder etwas gemeint sei (Wiktionary o. J.). Das geschieht alltäglich. So sind Kinder zum Beispiel große Forschende, erkunden ihre Umgebung, lernen durch Beobachtung. Aber auch Erwachsene forschen auf vielfache Weise: nicht nur in Kriminalromanen nach Täter:innen, sondern auch nach wahren Beweggründen, günstigen Bezugsquellen oder dem Sinn hinter dem Gesagten…. So gesehen ist Forschen ein Modus der Weltaneignung und eine der Grundlagen menschlichen Handelns.
Häufig wird das Wort aber mit einem anderen in enge Verbindung gebracht: Wissenschaft. Im Gegensatz zum individuellen forschenden Bemühen ist die wissenschaftliche Forschung nach gängiger Vorstellung in eine scientific community eingebettet, die auf der Basis gemeinsam geteilter Begriffe, Theorien und Hypothesen agiert (Merton 1973; Bray und von Stoch 2017), systematisch auf Vorwissen aufbaut, Untersuchungsansätze und -ergebnisse intersubjektiv kritisch prüft und so deren Gültigkeit feststellt – bis neue Forschungsergebnisse den bisherigen Erkenntnistand ändern.
In ständiger Veränderung begriffen ist auch die Stadtentwicklung – und zwar in doppelter Hinsicht: Stadt entwickelt sich und wird entwickelt (Albers 1988: 51; Campbell und Fainstein 1996 (a;b)). Auf beides kann sich wissenschaftliches Forschen richten: Verstehen, warum und wie sich die Stadt entwickelt. Und: Analysieren, wie (öffentliche) Akteure auf diese Entwicklungen Einfluss nehmen.
Womit bereits der dritte Schlüsselbegriff für die nachfolgenden Überlegungen ins Blickfeld gerät. Denn Veränderungen der Stadt können auch als Transformationen bezeichnet werden – und zwar ebenfalls im doppelten Sinne (sich transformieren/ transformiert werden). Damit entsteht ein interessantes Begriffsdreieck, durch das es zu navigieren gilt. Als Orientierungshilfe dient dabei die Doppelfrage nach Nähe und Distanz. Die ist zunächst auf das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft allgemein bezogen. Und wird abschließend noch einmal für das Handlungsfeld Stadtentwicklung gestellt.
Angesichts der Weite dieses thematischen Dreiecks und der vielen Wissensbestände, die zu durchqueren sind, muss der Argumentationsgang skizzenhaft bleiben. Das findet in der Form von Notizen seinen Ausdruck, die wie Trittsteine aneinandergereiht durchs Thema führen: Am Anfang steht eines der ausdrucksstärksten Bilder für wissenschaftliche Entwicklung: Riesen, auf deren Schultern sich weiter blicken lässt (1). Dass eine solche Wissenschaftsentwicklung sich nur auf Grundlage bestimmter Regeln und Grundsätze vollziehen kann, wird im Anschluss behauptet (2) und stößt sofort auf Widerspruch (3). Der mündet vor allem in der These, dass Wissensfortschritt nicht nur innerhalb des Wissenschaftssystems erzeugt werden kann. Folgt man ihr bleibt das nicht ohne Konsequenzen, wie sich sowohl am Beispiel der Bürgerforschung (4) wie der Aktionsforschung (5) zeigen lässt. Noch einen Schritt weiter geht das Konzept der mode 2-science (6), mit dem der Wissenschaft insgesamt ein Ort in der Schnittstelle zur Gesellschaft zugewiesen und damit eine herausfordernde Balance abverlangt wird. Ob das allgemein zur Wissenschaftsentwicklung Gesagte auch für das Handlungsfeld Stadtentwicklung Geltung hat, wird abschließend gefragt (7). Das Ergebnis mag überraschen – trägt aber dazu bei, das Bild von den Spannungsfeldern zu komplettieren (8).

1 | Auf den Schultern von Riesen: das OTSOG-Prinzip
Ein Zwerg, der auf den Schultern von Riesen steht, kann weiter sehen als der Riese selbst. Dieser Satz, dessen genaue Formulierung umstritten ist, taucht seit dem 12. Jahrhundert in verschiedenen Varianten quer durch die europäische Geistesgeschichte auf. Immer aber ist die Kernaussagen klar: Die Riesen sind der Wissensbestand, den eine Disziplin angehäuft hat und die Zwerge sind wir, die heute Forschenden (siehe Abbildung 1). Erst wenn wir das vorhandene Wissen nutzen, darauf aufbauen, es prüfend weiterentwickeln, weitet sich unser Horizont – womöglich über das hinaus, was bislang erkennbar war. Anders ausgedrückt: Erkenntnisfortschritt setzt Aufbauarbeit, setzt Kontinuität voraus. Darauf hat der amerikanische Wissenschaftssoziologe Robert K. Merton schon in den 1960er Jahren hingewiesen (Merton 1980; Mackert und Steinbicker 2013). Den Titel seines Buches „On the Shoulders of Giants“ hat er selbst, der amerikanischen Lust am Akronym frönend, später zu OTSOG verkürzt. Und der war wiederum Ausgangspunkt für manchen gelehrten Gedankenaustausch – unter anderem mit Umberto Eco zum gleichen Thema (Merton 1993).
Forschung, die sich nicht der Mühe unterzieht, die Schultern zu erklimmen, bleibt verzwergt.
Ihr wird jede Frage zu einer neuen – während man von der Schulter aus sehen könnte, woher sie kommt, was alles schon zu ihrer Beantwortung erarbeitet wurde und was davon für die Zukunft möglicherweise nutzbar ist. Solche Einsichten sind nicht im Alleingang zu gewinnen, sondern Teamwork. Genauer: im Dialog mit der jeweiligen scientific community zu gewinnen. Ohne ihre kritisch-distanzierte Prüfung, ohne organized skepticism (Merton 1973) kein wissenschaftlicher Fortschritt. Das setzt allerdings den Bezug zu gemeinsamen Begriffen, Kriterien und Regeln voraus.
Stark vereinfacht ausgedrückt kann man sagen: Innerwissenschaftlich erzeugte Grundlagen sind Voraussetzung für praktische Umsetzung. Übersetzt in aktuelle Themen: Ohne langjährige Grundlagenarbeit mit messengerRNA in einer breiten community kein Impfstoff gegen Covid-19. Ohne fast vier Jahrzehnte Arbeit an Klimamodellen in einer produktiv mitwirkenden Wissenschaftsgemeinschaft keine politische Einsicht in die Dringlichkeit praktischen Handelns. Eine so verstandene Wissenschaft funktioniert nicht auf Zuruf, sondern bedarf einer gewissen Autonomie und Kontinuität – was die Thematisierung ebenso betrifft wie das eigene Regelwerk und die Mechanismen der Paradigmenentwicklung.
2 | Elfenbeinturm? Wissenschaftliche Entwicklung als rationaler Prozess
1962 hat Thomas S. Kuhn (Kuhn 1973) in seiner zentralen Arbeit „Zur Struktur wissenschaftlicher Revolutionen“ den Begriff des Paradigmas eingeführt. Darunter versteht er zum Beispiel „allgemein anerkannte wissenschaftliche Leistungen, die für eine gewisse Zeit einer Gemeinschaft von Fachleuten maßgebende Probleme und Lösungen liefern.“ Dazu gehören Modelle, Begriffe, Werte, Theorien. Dies ist die auf anerkannte Paradigmen gestützte Phase der normal science. Die Entdeckung neuer oder bislang wenig beachteter Fakten die Falsifikation früherer zentraler Hypothesen und/oder die Entwicklung neuer, leistungsstarker Theorien kann diese Basis ins Wanken bringen. So entstehen wissenschaftliche Revolutionen, die letztlich in neue Paradigmen münden.
Das alles spielt sich innerhalb einer wissenschaftlichen Community ab und vollzieht sich nach deren Regeln. Womit außerwissenschaftliche Bezüge nicht ausgeschlossen wären. Sie gelten aber erst dann als tragfähig, wenn die notwendigen Grundlagen geschaffen wurden: Solange die Entwicklung einer Wissenschaft noch nicht zu einer fundamentalen Theorie geführt hat […] bleibt jeder Versuch, die Wissenschaftsentwicklung an externe Zwecksetzung zu binden wenig aussichtsreich. Es fehlt die für die Zweckforschung notwendige theoretische Basis an der Grundlagenforschung – das heisst es fehlen nicht nur die speziellen Grundlagen des zu bearbeitenden Problems, sondern die allgemeinen theoretischen Grundlagen des Gebietes überhaupt.
„Der Versuch, zweckorientierte angewandte Forschung zu machen wird daher auf die Notwendigkeit verwiesen, zunächst diese Grundlagen zu entwickeln.“
(Böhme et al. 1974: 290)
Die hier zitierten Autoren stellen im gleichen Zusammenhang jedoch auch fest, dass dennoch oft eine um den Kostenfaktor Theorie verbilligte Finalisierung betrieben werde. Das aber habe absehbar negative Folgen. Die wesentlichste: Wissenschaftliche Ansätze keimen und verdorren wie das jeweilige „Klima“ das will (Narr und Offe 1976: 24).
Selbstbezüglichkeit und Distanz zur Außenwelt haben allerdings auch Schattenseiten, die letztlich zum Bild des Elfenbeinturmes führen. Dessen Bewohnerschaft scheint entrückt von den gesellschaftlichen Entwicklungen um sie herum vorrangig mit sich selbst beschäftigt zu sein. Das wurde nicht nur von außen kritisiert. Und so gab es verschiedene Angriffe auf den und Ausbruchsversuche aus dem Elfenbeinturm (siehe Abbildung 2). Mit ihnen wird sowohl kritisch nach Resultat und Nutzen der wissenschaftlichen Arbeit, wie nach denen, die an der Erarbeitung von Wissen mitwirken, gefragt (siehe Abbildung 3). Ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit sollen hier nur einige Facetten benannt werden:
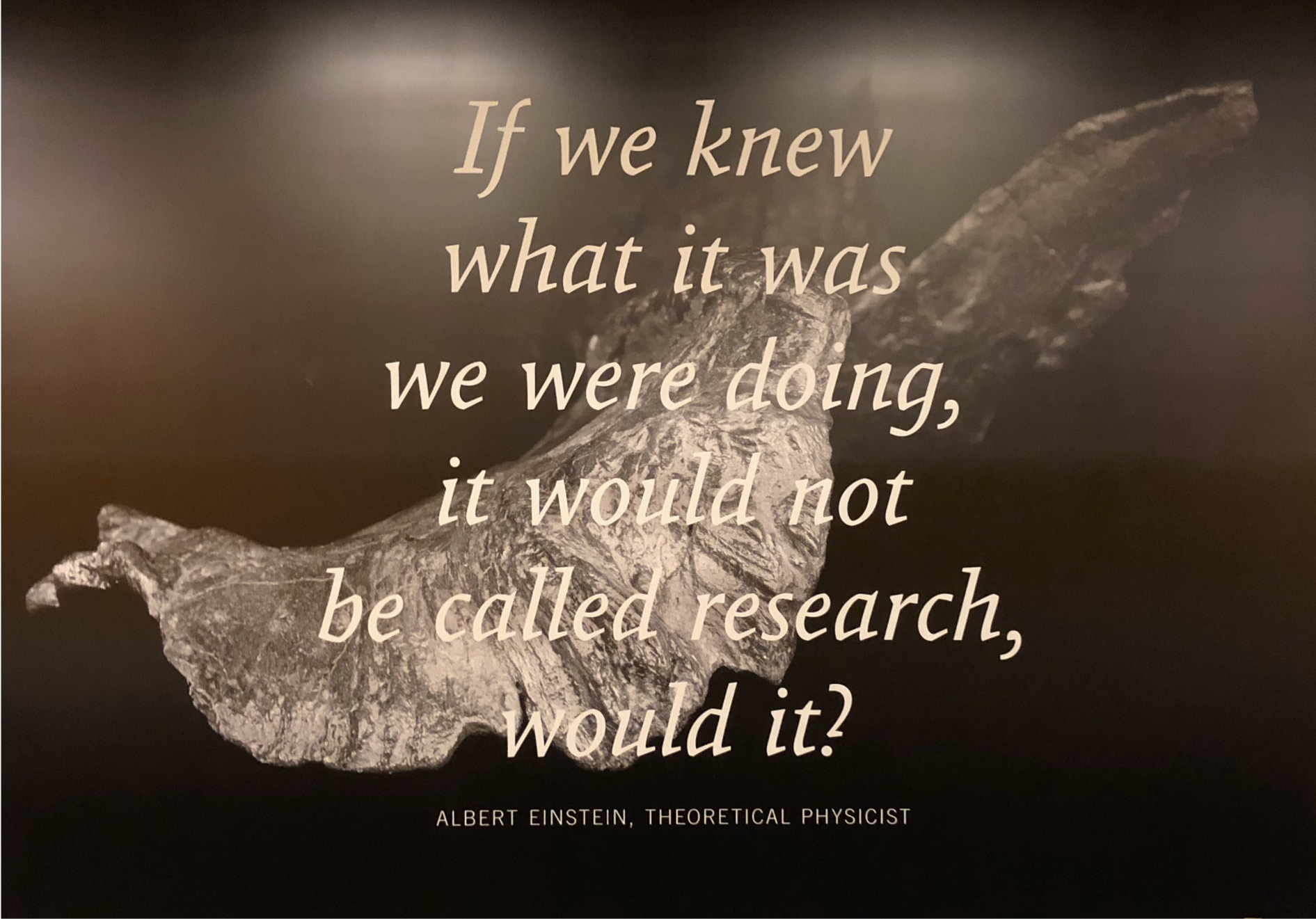
3 | Widerspruch: „Anything goes“
Der wohl provokanteste und umstrittenste Aufrührer wider den Elfenbeinturm war der Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Paul Feyerabend. Er attackierte Auffassungen wie die von Kuhn und insbesondere von Karl Popper – dessen Schüler er war – auf das Heftigste. Deren Vorstellung, dass sich Wissenschaft nach rationalen Regeln entwickele, sei schlicht unzutreffend.
In seinem Buch „Against Method“, dessen deutschsprachiger Titel „Wider den Methodenzwang“ das Gemeinte etwas genauer bezeichnet, entwickelt Feyerabend eine, wie es im Untertitel des Buches heißt, anarchistische Erkenntnistheorie (Feyerabend 1976). Darin erläutert er anhand zahlreicher Beispiele aus der Wissenschaftsgeschichte, dass neue Ansichten nicht aus theoretisch-methodischer Strenge resultierten, sondern oft aus Zufall oder aus anfänglich als absurd abgetanen Ideen von Außenseitern entstanden. Feyerabends Folgerung: Es gibt keine durchgängigen Rationalitätskriterien und methodischen Grundsätze, die Wissenschaftsentwicklung erklären und einen innerwissenschaftlichen Kompass bieten könnten.
Vielmehr gäbe es viele Methoden, Theorien und Konzepte – bis hin zu Religionen und Mythen –, die zu Erforschung und Verständnis der Welt nützlich sind.
Kurzum: Wer beschreiben wolle, wie Wissen sich entwickelt, könne nur zu einer Folgerung kommen: „Anything goes“ (Feyerabend 1976: 32; ausführlich zu diesem heftig umstrittenen Zitat: Feyerabend 1981: 97).
Damit wird zugleich die Trennung zwischen professionellen Wissensproduzent:innen in einem bestimmten Fach und allen anderen grundsätzlich infrage gestellt: Die Rede von den speziellen Methoden der Wissenschaft, die „ideologisch verseuchte Ideen“ (Feyerabend 1976: 387) in wahre und nützliche Theorien verwandeln sei ein Märchen. Das habe eine Funktion: „die Großen Tiere vor den Massen (Laien, nichtwissenschaftliche Fachleute oder Wissenschaftler anderer Fachgebiete)“ zu schützen. „Nur jene Bürger zählen, die den Zwängen der wissenschaftlichen Institutionen ausgesetzt waren (eine lange Ausbildung durchgemacht haben), die ihnen erlegen sind (auch ihre Prüfungen bestanden haben) und die jetzt von der Wahrheit des Märchens fest überzeugt sind“ (Feyerabend 1978: 51). Mit der Kritik am Bild einer wissenschaftlichen Elite, die sich allein zu Forschung und Wissensproduktion berufen fühlt, reißt er sozusagen eine firewall zwischen Theorie und Praxis ein: „Bürgerinitiativen statt Erkenntnistheorie“ fordert Feyerabend plakativ, oder: „freie Methoden für freie Menschen“ (Feyerabend 1981: 8, 77).
4 | Alle forschen: Feyerabend beim Wort genommen?
„Plastikpiraten-Studie belegt massives Müllproblem an deutschen Flüssen“ (Ecologic Institut gemeinnützige GmbH 2018). Die Forschungsergebnisse, auf die diese Überschrift aufmerksam macht, basieren auf Daten, die von 17.000 Schülerinnen und Schülern – im Wortsinne – zusammengetragen und danach von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ausgewertet wurden.
Das sei, heißt es im erläuternden Text, ein typisches Beispiel für Citizen-Science, bei der „sich an Wissenschaft interessierte Menschen direkt in den Forschungsprozess einbringen [können]. Man spricht daher auch von Bürgerwissenschaften: Wissenschaftlerinnen und Forscher arbeiten mit Bürgerinnen und Bürgern Hand in Hand“ (BMBF o.J.). Das Spektrum solcher Projekte ist breit und bunt. Sie beziehen sich nicht nur auf das Sammeln von Dingen und Daten, sondern zum Beispiel auch auf die Identifikation von Gefahrenstellen im Straßenverkehr, die Bewertung der Barrierefreiheit von Orten oder die Geschichtsdarstellungen in Sozialen Medien etc. Diese Vielfalt ist nicht zuletzt der Tatsache zuzuschreiben, dass Bürgerforschung inzwischen den Rang eines Schwerpunktes (BMBF 2017; Wissenschaft im Dialog gGmbH o.J.) im Förderprogramm des Bundes-Wissenschaftsministerium hat. Aus gutem Grunde, wie das folgende Zitat zeigt: „Wissenschaftliche Ergebnisse aus Citizen-Science-Projekten können Beiträge für Entscheidungsfindungen in politischen und planerischen Prozessen liefern. Lösungen für alltägliche Probleme können lebensnah entwickelt werden. Dies betrifft z.B. die Erforschung von bürgernahen Themen aus den Bereichen Umwelt, Gesundheit und nachhaltige Entwicklung im lokalen und regionalen Umfeld.“ (Bonn et al. 2016: 31). Es wäre allerdings zu kurz gegriffen, wenn nur Beispiele in den Blick genommen würden, die aus dem heutigen Wissenschaftssystem stammen und seinen Regeln folgen.
Citizen Science ist vielmehr deutlich älter als der Name nahe legt und schon lange in der Zivilgesellschaft verankert – als Domäne ehrenamtlich tätiger und zumeist nicht professioneller Forscherinnen und Forscher.
Ein Paradebeispiel war lange Zeit die lokale Geschichts- und Heimatforschung. Ihr haben in der öffentlichen Wahrnehmung inzwischen die vielfältigen Aktivitäten im Bereich des Naturschutzes ein wenig den Rang abgelaufen – etwa die Zählungen von Tierarten (Storz und Auer 2019), Erhebungen von Umweltdaten etc. Hier gibt es inzwischen sogar Projekte mit internationaler Reichweite – wie zum Beispiel den „tea bag index“ (Universität für Bodenkultur Wien o.J.) mit dem die Qualität von Böden gemessen wird.
Mit dem Aufkommen neuer technischer Möglichkeiten scheinen die Aktivitäten in diesem Feld noch einmal deutlich zugenommen zu haben. „Auf der Plattform Bürger schaffen Wissen können Bürger aus mehr als 120 Projekte wählen. Mit der App Clusterkopfschmerzen erforschen eigene medizinische Daten beitragen, mittels Hush City ruhige Plätze in Städten markieren oder in ›Verlust der Nacht‹ die Lichtverschmutzung dokumentieren“ (Nohrden 2019; Rall 2019).
Lange Zeit sind solche Aktivitäten von richtigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern belächelt worden. Und auch heute gibt es noch Vorbehalte. So heißt es etwa im Grünbuch Citizen Science Strategie 2020: „Weiterhin bestehen Ängste vor zu starker Mitbestimmung von Bürgerinnen und Bürgern in der Forschungsausrichtung und -förderung, die zur Dominanz von populären oder anwendungsorientierten Forschungsthemen auf Kosten von weniger leicht zugänglichen Themen und Grundlagenforschung führen könnte“ (Bonn et al. 2016: 29). Da kommen nicht nur Befindlichkeiten großer Tiere, wie Feyerabend sie nannte oder professionelle Eitelkeiten zum Ausdruck, sondern auch elementare Fragen. Etwa: Wie groß muss die Distanz der Wissenschaft zu dem sein, was gerade als opportun, populär, en vogue erscheint? Und wie nah müsste sie den Lebenswelten kommen, um als relevant wahrgenommen und tatsächlich wirksam zu sein?
5 | Bücher allein reichen nicht: Aktionsforschung und Co
Mehrere Jahrzehnte vor Feyerabend wurde die Distanz zwischen Wissenschaftssystem und Praxisakteuren bereits auf andere Weise angegangen: 1946 stellte der deutsch-amerikanische Psychologe Kurt Lewin provokativ fest „Research that produces nothing but books will not suffice“ (Lewin 1946: 203). Seine Forderung: Forschung müsse auch in praktische Veränderungen, in „social action“ münden. Womit der Begriff geboren war: „action-research“ (ebd.).
Die auf Lewin aufbauende Aktionsforschung umfasst heute eine bunte Vielfalt von Anwendungsfeldern. Sie reichen vom Management in Unternehmen über Schulentwicklung, Gesundheitspolitik oder Sozialarbeit bis zur kollektiven Wissensproduktion im Kampf gegen Unterdrückung vor allem im globalen Süden. Trotz aller Heterogenität lassen sich zumindest zwei gemeinsame Charakteristika benennen: Forschung wird nicht allein von Mitgliedern des Wissenschaftssystems betrieben. Vielmehr sind die Akteure im untersuchten Feld – in unterschiedlichem Maße – aktiv Mitwirkende. Und: Forschen soll in Verändern münden. Gerade dieser Aspekt kann als Unterscheidungsmerkmal zu den vorgenannten Ansätzen dienen – wenngleich die Grenzen fließend sind.
Strategien der Aktionsforschung münden unter Idealbedingungen in zyklischen Prozessen: Forschungsfragen resultieren aus einer dialogisch angelegten Reflexion der Ausgangssituation in der Praxis. Die daraus resultierenden Untersuchungsschritte werden kooperativ durchgeführt und ausgewertet, um dann Konsequenzen für die Veränderung praktischen Handelns zu ziehen.
Bei der Rezeption und Diskussion von Konzepten der Aktionsforschung wird allerdings gelegentlich übersehen, dass dieser Forschungstypus das traditionelle Wissenschaftsverständnis nicht ablösen, sondern lediglich ergänzen sollte.
Bereits in dem schon erwähnten Aufsatz von 1946 stellt Lewin fest: “Progress will depend largely on the rate with which basic research in social sciences can develop deeper insight into the laws which govern social life. This ›basic social research‹ will have to include mathematical and conceptual problems of theoretical analysis” (Lewin 1946: 203).
Diese Zweigleisigkeit von basic research und action research ist von grundsätzlicher Bedeutung, durchzieht das bisher Gesagte und mündet immer wieder in die gleiche Frage: Wie verhält sich die innerwissenschaftliche Entwicklung zu dem, was außerhalb – im gesellschaftlichen Bezugs- und Umfeld – erfahren und erforscht wird? Wie weit kann (und muss?) wissenschaftliche Forschung auf eigener Thematisierungs- und Methodenkompetenz beharren, die Kontinuität der eigenen Entwicklung wahren und das Allgemeine über das Besondere hinaus im Blick behalten? Oder noch kürzer gefragt: Wieviel Distanz ist nötig?
Wem die Diskussion über Partizipation allgemein vertraut ist, dem wird diese Art von Fragen bekannt vorkommen. Denn in der Tat stellen sie sich überall dort, wo Fachleute und Lai:innen miteinander in Dialog treten (Selle 2018). Insofern ist es auch nicht überraschend, dass viele der hier angesprochenen Strategien gelegentlich unter der Überschrift partizipative Forschung zusammengefasst werden (Kasberg et al. 2021; Ziems und Schnur 2019; von Unger 2014).
Allerdings gibt es überall dort, wo mit der Partizipation in Forschungsprozessen nicht allein wissenschaftliche Erkenntnis erzeugt, sondern auch Veränderungen im Forschungsfeld bewirkt werden sollen, eine interessante Gegenfrage. Sie lautet: Wären die angestrebten Veränderungen nicht ebenso oder gar leichter ohne wissenschaftliche Beteiligung erreichbar gewesen? Entsteht aus der Sicht derer, die Veränderungen wünschen, tatsächlich ein Mehrwert? Oder ist Wissenschaft eher ein Klotz am Bein? Wären Fachleute oder Verbündete anderer Art womöglich hilfreicher? Noch kürzer gefragt: Wieviel Nähe ist erwünscht?
6 | An der Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft:
Mode 2-science und Reallabore
1994 veröffentlichten Michael Gibbons, Camille Limoges, Helga Nowotny und andere ein Buch mit dem Titel “The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies”. Schon der Untertitel signalisiert, dass hier Wissenschaft nicht isoliert, sondern in ihrem Verhältnis zur Gesellschaft thematisiert wird. Sie beschreiben darin zwei Arten von Wissensproduktion: die traditionelle (mode 1), die vor allem an Universitäten und innerhalb disziplinärer Grenzen nach den dort jeweils geltenden Maßstäben vorangetrieben wird und eine neue (mode 2), die Disziplinengrenzen überschreitet, anwendungsorientiert ist und sich dabei am gesellschaftlichen Bedarf orientiert (Gibbons et al. 1994; Nowotny et al. 2003).
Dieser Ansatz erzeugte großen Widerhall. In Deutschland fand er zum Beispiel unmittelbar Niederschlag in der sich Anfang der 2000er Jahre etablierenden Sozialökologischen Forschung als, wie Becker schreibt, „Typus einer transdisziplinären, an gesellschaftlichen Problemen orientierten Forschung […], die sich an der Schnittstelle von Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit formiert“ (Becker 2016: 393). Als weitere Merkmale werden ihm unter anderem zugeschrieben: Die Wissensproduktion rückt aus dem Kontext einer einzelnen wissenschaftlichen Disziplin mit ihren eigenen Relevanz- und Qualitätskriterien in gesellschaftliche Anwendungszusammenhänge und wird in bewusster sozialer Verantwortung betrieben. Zu der Frage, wie dies geschieht, welche Methoden zur Anwendung kommen und – last but not least – was mit Öffentlichkeit gemeint ist, welche Akteure also einbezogen werden, gibt es inzwischen zahlreiche Überlegungen (Brinkmann et al. 2015: 67).
Mit dieser Programmatik in ihren Segeln nahmen Strategien partizipativen Forschens erheblich an Fahrt auf.
Ein – zumindest der Bezeichnung nach – neues Element in diesem Kontext waren und sind so genannte Reallabore (Schneidewind 2014). Das Wort ist bildmächtig: Die Wissenschaft verlagert ihre Labore in die Realität. Führt dort, in und mit der Gesellschaft ihre Experimente durch: „Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler [sollen sich] in reale Veränderungsprozesse begeben. Sie begleiten zum Beispiel die Sanierung von Stadtteilen oder die Einführung neuer Mobilitäts- und Energiesysteme. In Reallaboren werden Praktiker aus Kommunen, Sozial- und Umweltverbänden oder Unternehmen von Anfang an in den Forschungsprozess einbezogen. Forschungsfragen eines Umweltverbandes, einer Energiegenossenschaft oder eines Fahrradclubs können dabei ebenso einfließen, wie die eines Technologiekonzerns. In diesem ergebnisoffenen Prozess entsteht Wissen, das in der Praxis etwas bewirkt.“ (MWK o. J.)
Die Aufzählung derer, die hier involviert werden könnten, signalisiert schon, dass sehr verschiedene Akteure potentiell Mitwirkende sein könnten – vor allem diejenigen, die zum jeweils ins Auge gefassten Experiment etwas beizutragen vermögen (Libbe und Marg 2021: 7). Insofern führt die Einordnung der Reallabore in die Kategorie der partizipativen Strategien ein wenig in die Irre, wird doch unter Partizipation in der Regel allein oder vor allem die Beteiligung einer nicht-organisierten Öffentlichkeit verstanden.
Innerhalb eines knappen Jahrzehnts hat die Reallabor-Idee eine rasante Entwicklung genommen. Das wird zum Beispiel im Rahmen des BMBF-Schwerpunktes „Forschung für Nachhaltigkeit (FONA)“ (fona.de) deutlich. Mit Blick auf die Vielfalt dessen, was insgesamt mit dem Reallabor-Etikett versehen wird, muss man zwar skeptisch anmerken, dass hier research-follows-ressources ebenso wirksam ist wie das buzzwording mit modischen Begriffen:
Vieles gab es schon früher unter anderen Bezeichnungen (Pilotprojekt, Experiment etc.) und nicht überall ist Wissenschaft drin, wo Wissenschaft draufsteht.
Aber das soll die Entwicklung nicht entwerten. Hier ist auf breiter Basis etwas in Bewegung geraten, das vorher nur vereinzelter Versuch war. Dennoch sind die Fragen nach Distanz und Nähe damit nicht schon beantwortet, sondern stellen sich in gleicher Weise – zum Teil sogar noch deutlicher: Die Verringerung der Distanz zwischen Wissenschaft und Gesellschaft wird hier angestrebt – das ist offensichtlich. Wer gibt die Fragen vor? Wer benennt die Herausforderungen (auf die Wissenschaft reagieren soll)? Wie werden solche Fragen dort beantwortet, wo gewichtige Praxis-Akteure mitwirken? Wie steht es um notwendige Distanz, also wie skeptisch und kritisch kann Wissenschaft in solchen Konstellationen sein? Welche Akteure werden (nicht) einbezogen? (Gebhardt und König 2021) Und damit auch hier die Gegenfrage aus der Perspektive der Gesellschaft: Wer will diese Nähe der Wissenschaft, wem nutzt sie (nicht)?
Um die richtigen Maßstäbe an Rolle und Ertrag von Reallaboren anlegen zu können muss man sich zudem vergewissern, welche Absichten mit ihnen verfolgt werden. Eine Antwort auf diese Frage lautet: „Die Aktivitäten dienen […] der Entwicklung, Anpassung und Verbreitung von Technologien“ (Libbe und Marg 2021: 7). Dass es in der Breite der Reallabor-Landschaft nicht nur um Technologien geht, ist sicher unstrittig – auch wenn sie etwa im Smart-City-Kontext im Vordergrund zu stehen scheinen. Aber davon abgesehen verweisen die Begriffe Anpassung und Verbreitung deutlich darauf, dass es hier primär um Fortschritte der Praxis und nicht der Wissenschaft geht. Das kommt auch darin zum Ausdruck, dass die methodisch durchaus heikle Frage nach der Verallgemeinerungsfähigkeit in diesen Kontexten selten, die nach der Übertragbarkeit hingegen oft gestellt wird. Es handelt sich also im Sinne der eingangs beschriebenen Unterscheidungen um eine Art Zweckforschung: Wissenschaftliche Erkenntnisse sollen unter realen Bedingungen weiterentwickelt, praxistauglich und verbreitet werden.
Dabei bleibt es von Interesse, ob eine Balance zwischen action und basic-research, wie sie etwa bei Lewin (1946) angelegt war, beabsichtigt und möglich ist. Eine Frage, die sich in noch deutlicherer Form im folgenden Beispiel stellt.
7 | Stadtentwicklung aus der Praxis für die Praxis?
„Die großen Transformationsprozesse im 21. Jahrhundert werden sich insbesondere in den Städten entscheiden“ (Schneidewind 2020: 139). Und: „Die Städte erwarten von der Wissenschaft einen relevanten Beitrag für die Lösung ihrer Probleme“ (BMBF 2021). Feststellungen und Erwartungen wie diese sind derzeit oft zu hören.
Das Problem scheint klar zu sein. Es geht um Lösungen. Das kann als Arbeitsauftrag an ein breites Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen verstanden werden, die sich mit Stadtentwicklung auseinandersetzen – und aktuell etwa unter dem Stichwort Transformationsforschung einen gemeinsamen thematischen Nenner gefunden haben (Höcke und Schnur 2021). Jede dieser Fachwelten hat ihre eigenen Begriffe, Methoden, Forschungstraditionen und Praxisbezüge. Das lässt es nicht zu, sie alle über einen Kamm zu scheren. Daher sei hier – als Schlussstein der Argumentation – mit der Stadtplanung lediglich ein Bereich herausgegriffen, in dem manches anders zu sein scheint.
Historisch betrachtet stellt sich die Frage nach Nähe im Handlungsfeld Stadtplanung gar nicht erst. Sie war von Anfang an Gebot. Raymond Unwin gab bereits 1910 das Leitmotiv vor: „Wir werden gut daran tun, gegenwärtig die Aufstellung bestimmter Lehrsätze für unsere Theorie zu vermeiden (und) in engster Fühlung mit den tatsächlichen Erfordernissen zu bleiben“ (Albers 2004: 101). Genau das geschah und geschieht. Und führt dazu, dass Vieles von dem, was an Öffnungsprozessen in der allgemeinen Wissenschaftsentwicklung erst angestrebt wird, hier schon seit langem Praxis ist. Beispiele gefällig? (Kanning 2018)
- Reallabore gibt es seit 1901 – in der Form Internationaler Bauausstellungen (IBA). Die waren anfangs noch eher Musterschauen, sind aber spätestens seit den 1980er Jahren zu groß angelegten, oft über 10 Jahre sich erstreckenden und bis zu 100 Einzelprojekte umfassenden Experimentierfeldern geworden (BBSR o. J.). Und dabei als Format so erfolgreich, dass selbst in Japan und Australien die Frage gestellt wird, ob man nicht auch so etwas benötige.
- Die Regionalen in Nordrhein-Westfalen greifen die Idee der Internationalen Bauausstellungen als befristeter Ausnahmezustand auf und setzen ihn räumlich und inhaltlich in kleinerem Maßstab um (MHKBG NRW o. J.).
- In den Programmen des Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus, die es auf der Ebene des Bundes und in einigen Ländern gibt, wird eng orientiert an aktuellen Aufgaben das geleistet, was der Titel verspricht: Als innovativ empfundene Projekte werden identifiziert, gefördert und begleitend ausgewertet (Diller und Willinger 2019).
- Und nicht zu vergessen: Viele der zuvor (Notizen 4-6) genannten Merkmale partizipativer und transdisziplinärer Forschungs- und Erprobungsstrategien – sei es die Teilhabe der Öffentlichkeit an Orts- und Problemerkundungen oder die Kooperation mit Praxisakteuren bei der Entwicklung von Problemlösungen – sind hier ebenfalls seit langem Praxis.
Die Liste ließe sich verlängern.
Alles das ist Handeln aus nächster Nähe. Ideen, Konzepte und Strategien werden in der Praxis und aus der Praxis für die Praxis entwickelt – in besonderen Fällen unter freundlicher forschender Begleitung. Labore müssen nicht erst aus den Gehäusen der Wissenschaft ausgelagert werden, um Veränderungen zu erproben. Experimente aller Art entstehen vielmehr in der Praxis selbst – ausgelöst von der Ressortforschung, der Landes-, Regional- oder Kommunalpolitik, von Verbänden oder auch zivilgesellschaftlichen Initiativen und vielen mehr. Man fühlt sich an Feyerabend erinnert: Anything goes.
Während also zuvor die Frage der Nähe aus der Perspektive der Distanz gestellt wurde, findet hier eine Umkehrung statt: Aus der Praxis-Nähe stellt sich die Frage nach Notwendigkeit und Möglichkeit von Distanz: Welcher Art müsste eine Wissenschaft der Stadtplanung sein, die transformative Prozesse unterstützt und fördert?
In der Tat gibt es so etwas wie ein „stadtplanungsspezifisches Wissenschaftsverständnis“ (Zlonicky und Zlonicky 1974: 1276). Es kündet allerdings wieder von Nähe. Gerd Albers etwa vertrat die Auffassung, dass der „Anteil der Theorie an der Stadtplanung […] kaum etwas anderes sein [kann] als die systematische Aufbereitung von Beobachtungen und Erfahrungen, die sich auf die Entwicklung der Städte, auf Methodik und Inhalte möglicher Steuerungsmaßnahmen und auf deren Auswirkungen beziehen“ (Albers 1988: 18). Und John Forester ergänzte, man müsse auf die Praxis hören und daraus Erkenntnisse gewinnen: “Listen carefully to practice stories and to understand who is attempting what, why, and how, in what situation, and what really matters in all that” (Forester 1993: 202).
Der Beitrag einer so verstandenen Wissenschaft könnte also vor allem darin bestehen, dass über den einzelnen Fall hinaus Beobachtungen und Erfahrungen gesammelt und das jeweilige Was, Warum, Wie etc. näher betrachtet wird. Damit dies gelingt müssten jedoch vier Klippen umschifft werden:
Aktualität: Forschungsansätze keimen und verdorren wie es das jeweilige „Klima“ will, hieß es eingangs im Zusammenhang mit der „Finalisierung“ von Forschung (Böhme et al. 1974: 290). Zweifellos geht es bei Bauausstellungen und experimentellem Städtebau um eben das: aktuelle Herausforderungen und innovative Lösungen. Was aber ist mit den gehabten Erfahrungen? Mit Längsschnitten, die Entwicklungen über den Einzelfall hinaus abbilden können?
Selektivität: Ausdrücklich handelt es sich zum Beispiel bei städtebaulichen Experimenten um Ausnahmen. Sie entstehen unter Sonderbedingungen. Aber was ist mit den Normalfällen, mit der die Praxis auch weiterhin dominierenden Regel? Sie scheint häufig weiterer Betrachtung nicht wert. Die Folge: Über Festivalisierung der Stadtentwicklung weiß man mehr als über die Wirksamkeit gewöhnlicher Stadtentwicklungspläne. Und dem Handeln neuer Akteure wird viel Aufmerksamkeit gewidmet, während die traditionellen (obwohl sie weiterhin den größten Anteil an der Stadtentwicklung haben) aus dem Blickfeld geraten etc.
Banalität: Hartmut Häußermann und Walter Siebel haben schon vor langer Zeit befürchtet, dass ein zu starker Praxisbezug die Ergebnisse von Stadtforschung banal werden lassen könnte. Sie wiederhole dann lediglich, was die in der Praxis Tätigen schon wissen und bestätige so der Praxis, „dass die Wissenschaft es genauso sieht.“ (Häußermann und Siebel 1978)
Kausalität: Was eigentlich sind die Ursachen für das Auftreten von Problemen, für die man (experimentell) nach Lösungen sucht? Und was sind die Gründe, die zum Erfolg oder zum Scheitern führen? Diese Fragen verweisen noch einmal auf den Doppelcharakter des Begriffs Stadtentwicklung (sich entwickeln/ entwickelt werden) und machen eine doppelte Aufgabe deutlich, die John Friedmann (1998: 251) so beschreibt: „The […] urban habitat takes form as multiple forces interact with each other […]. It is, therefore, obvious that planners need to have a good understanding of how these city-forming processes work […]. This formulation posits the city-forming process first, before there can be any serious talk of strategic intervention”. Mit anderen Worten: Wer Stadtentwicklung transformieren will muss ihre Dynamiken verstanden haben. Die Betrachtung des Handelns, der strategischen Intervention allein erklärt weder Scheitern noch Erfolg.
Eine so verstandene stadtplanungsspezifische Wissenschaft ist derzeit noch mehr Möglichkeit als Realität.
Und es wird unschwer erkennbar, dass sie, um ihr Potenzial auszuschöpfen zwei weitere Voraussetzungen schaffen müsste: anerkannte Methoden bereit zu stellen, mit denen Stadtentwicklungsprozesse in ihrem Doppelcharakter abgebildet werden können. Und die dafür erforderlichen Begriffe zu schärfen. Denn immer noch herrscht eine „geradezu abenteuerliche Grenzenlosigkeit des Planungsbegriffs“ (Keller 2006: 352).
Bleibt zu hoffen, dass die jüngsten Initiativen des transformativen Forschens nicht nur auf Praxisveränderung zielen, sondern auch dazu genutzt werden können, die Arbeit an den wissenschaftlichen Grundlagen des Faches weiter voranzutreiben. Denn nur dann könnte ein wirklich produktives Verhältnis von Praxis und Wissenschaft entstehen, das als „Korrektiv, Kompass und Referenzrahmen“ gleichermaßen dient (Höcke und Schnur 2021).
8 | Balance in Spannungsfeldern – auch eine Frage der Haltung
Ein Ergebnis der bisherigen Überlegungen liegt auf der Hand: Es geht beim (wissenschaftlichen) Forschen um Nähe und Distanz. Genauer: Um die Balance zwischen beidem. Dabei heißt Balance nicht Mitte. Sondern Bewegung. Und Dialog.
Eine Metapher aus den Zeiten der analogen Fotografie nutzend hat Patsy Healey (2012: 353) vor einiger Zeit gefordert, es gelte Praxis „im feineren Korn“ abzubilden. Also Nähe zu suchen, genauer hinzuschauen und präzisere Begriffe zu nutzen. Aber die Detaillierung erreicht Grenzen – ähnlich wie bei einem Bild, bei dem man aus größter Nähe, sozusagen in der Betrachtung des einzelnen Korns oder Pixels nichts mehr über das ganze Bild sagen kann.
Forschung ist also gehalten, bei allem Bemühen um Nähe, um Präzision oder Feinkörnigkeit, zugleich eine gewisse Distanz zu halten. Das kann man am ehesten durch Bewegung, durch einen Wechsel der Perspektive erreichen – indem man vor- und zurück tritt, um das Ganze und seine Teile in Beziehung zueinander setzen zu können (Geels 2019).
Dabei ist vor einem Missverständnis zu warnen, der im Reallabor-Begriff angelegt ist: Stadt und Stadtentwicklung könnten da wie Untersuchungsobjekte erscheinen, die von berufenen Fachleuten nicht nur seziert, sondern sogar transformiert werden sollen. Das wäre natürlich eine absurde Vorstellung. Denn Stadt ist ein soziales Gebilde. Und Stadtentwicklung ein sich ständig wandelndes Ergebnis des Handelns Vieler.
Also heißt Forschen hier auch und vor allem: kommunikationsfähig werden.
Das ist nicht mit Fragebögen oder Interviews zu erledigen. Sondern verlangt Zuhören. Forester hat den Ton vorgegeben: Es gilt, von Praxiserzählungen zu lernen. Aber das stellt Forschende auf eine harte Probe – und passt oft überhaupt nicht zu den Rahmenbedingungen ihres Handelns: zeitlich befristet vor Ort präsent, mit komplexem Untersuchungsdesign und beschränkten Ressourcen ausgestattet sowie unter hohem Ergebnisdruck… wie soll man da die Geduld aufbringen Sichtweisen kennen zu lernen, die womöglich überhaupt nicht zu den Fragen passen, mit denen man angetreten war? Wie geht man damit um, wenn die anderen Beteiligten Thematisierungskompetenz für sich beanspruchen? Wie verhält man sich, wenn man persönlich in die Pflicht genommen wird?
Die sich eröffnenden Rollenkonflikte können erheblich sein und insbesondere dort, wo die Praxisakteure nicht selbst artikulationsstark sind und ihre Interessen durchzusetzen wissen, zu heiklen Folgen führen (Kobbe 2010; Winter et al. 1987). Aber alles das verlangt nach einer ausführlicheren Diskussion, für die hier kein Raum mehr ist.
An dieser Stelle bleibt daher nur festzuhalten: Balance ist auch eine Haltungsfrage.
References
Albers, Gerd (1988): Stadtplanung. Eine praxisorientierte Einführung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Albers, Gerd (2004): Zur Rolle der Theorie in der Stadtplanung. Folgerungen aus fünf Jahrzehnten. In: Uwe Altrock et al. (Hg.): Perspektiven der Planungstheorie. Berlin: Leue Verlag.
BBSR (o. J.): Internationale Bauaustellungen. https://www.internationale-bauausstellungen.de, Zugriff am 11.03.2022.
Becker, Egon (2016): Keine Gesellschaft ohne Natur. Beiträge zur Entwicklung einer sozialen Ökologie. Frankfurt: Campus.
BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) (o. J.): Daten sammeln für die Wissenschaft. https://www.wissenschaftsjahr.de/2016-17/mitmachen/junge-wissenschaftsinteressierte/plastikpiraten/mitmachen-sammeln-hochladen.html, Zugriff am 11.03.2022.
BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) (2017): Bürgerforschung. https://www.bmbf.de/bmbf/de/ueber-uns/wissenschaftskommunikation-und-buergerbeteiligung/buergerbeteiligung/citizen-science/buergerforschung.html, Zugriff am 14.03.2022.
BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) (2021): Innovationsplattform Zukunftsstadt. https://www.fona.de/de/themen/zukunftsstadt.php, Zugriff am 11.03.2022.
Böhme, Gernot; van den Daele, Wolfgang und Krohn, Wolfgang (1974): Die Finalisierung der Wissenschaft. In: Werner Diederich (Hg.): Theorien der Wissenschaftsgeschichte. Frankfurt: Suhrkamp.
Bonn, Aletta; Richter, Anett; Vohland, Katrin; Pettibone, Lisa; Brandt, Miriam; Feldmann, Reinart; Goebel, Claudia; Grefe, Christiane; Hecker, Susanne; Hennen, Leonhard; Hofer, Heribert; Kiefer, Sarah; Klotz, Stefan; Kluttig, Thekla; Krause, Jens; Küsel, Kirsten; Liedtke, Christin; Mahla, Anika; Neumeier, Veronika A.; Premke- Kraus, Matthias; Rillig, Matthias C.; Röller, Oliver; Schäffler, Livia; Schmalzbauer, Bettina; Schneidewind, Uwe; Schumann, Anke; Settele, Josef; Tochtermann, Klaus; Tockner, Klement und Vogel, Johannes (2016): Grünbuch Citizen Science Strategie 2020 für Deutschland. Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig, Leipzig, Museum für Naturkunde Berlin, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung (MfN), Berlin-Brandenburgisches Institut für Biodiversitätsforschung (BBIB), Berlin.
Bray, Dennis und von Storch, Hans (2017): The Normative Orientations of Climate Scientists. In: Science and Engineering Ethics 23. Jg. H. 5, S. 1351–1367, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5636871/, Zugriff am 11.03.2022.
Brinkmann, Carina; Bergmann, Matthias; Huang-Lachmann, Jo-Ting; Rödder, Simone und Schuck-Zöller, Susanne (2015): Zur Integration von Wissenschaft und Praxis als Forschungsmodus - Ein Literaturüberblick, Report 23, Climate Service Center Germany, Hamburg.
Campbell, Scott und Fainstein, Susan (Hg.) (1996) (a): Readings in Planning Theory. Cambridge/ Oxford: Blackwell.
Campbell, Scott und Fainstein, Susan (Hg.) (1996) (b): Readings in Urban Theory. Cambridge/ Oxford: Blackwell.
Diller, Christian und Willinger, Stephan (2019): Pionier der praxisnahen Stadtforschung in Deutschland. Der Experimentelle Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) mit seinen Forschungsfeldern. In: Raumplanung H 200, 42-49.
Ecologic Institut gemeinnützige GmbH (2018.): Pressemitteilung: Plastikpiraten-Studie belegt massives Müllproblem an deutschen Flüssen. https://bmbf-plastik.de/de/plastikpiraten/pressemitteilung-2018-02, Zugiff am 14.03.2022.
Feyerabend, Paul (1976): Wider den Methodenzwang. Skizze einer anarchistischen Erkenntnistheorie. Frankfurt: Suhrkamp.
Feyerabend, Paul (1978): Das Märchen Wissenschaft. Plädoyer für einen Supermarkt der Ideen. In: Kursbuch Bd. 53, Augsburg.
Feyerabend, Paul (1981): Erkenntnis für freie Menschen. Frankfurt: Suhrkamp.
Forester, John (1993): Learning from Practice Stories: The Priority of Practical Judgment. In: Fischer, Frank und Forester, John (Hg): The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning, deGruyter/Duke University Press.
Friedmann, John (1998): Planning Theory Revisited. In: European Planning Studies Vol. 6, No. 3, 245-253.
Gebhardt, Laura und König, Alexandra (2021): Wie vermeiden wir den Matthäuseffekt in Reallaboren? Selektivität in partizipativen Prozessen. In: Raumforschung und Raumordnung. 79/4. https://rur.oekom.de/index.php/rur/article/view/64/169, Zugriff am 11.03.2022.
Geels, Frank (2019): Socio-technical transitions to sustainability: a review of criticisms and elaborations of the Multi-Level Perspective. In: Current Opinion in Environmental Sustainability (39), 187-201.
Gibbons, Michael; Limoges, Camille; Nowotny, Helga; Schwartzman, Simon; Scott, Peter und Trow, Martin (1994): The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. London: Sage.
Häußermann, Hartmut und Siebel, Walter (1978): Thesen zur Soziologie der Stadt. In: Leviathan H. 4/1978.
Healey, Patsy (2012): Communicative Planning: Practices, Concepts, and Rhetorics. In: Sanyal Bishwapriya et al. (Hg): Planning Ideas that Matter. Cambridge. London.
Höcke und Schnur (2021): Große Transformation, urbane Resilienz und nachhaltige Stadt. Fachdiskurse und Forschungspraxis – ein Überblick. vhw werkSTADT Nr. 57. Berlin.
Kanning, Helga (2018): Reallabore aus planerischer Perspektive. In: sustainify Arbeits- und Diskussionspapier, 3/2018. Hannover. https://www.sustainify.de/files/luxe/downloads/sustainify/03-2018-Relallabore-Planer.pdf, Zugriff am 11.03.2022.
Kasberg, Azize; Müller, Patrick; Markert, Claudia und Bär, Gesine (2021): Systematisierung von Methoden partizipativer Forschung. In: Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 64 Jg. H 2, 146–155. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7843478/, Zugriff am 14.03.2022.
Keller, Donald (2006): Neu wieder über Planung denken! In: Klaus Selle (Hg): Zur räumlichen Entwicklung beitragen. Konzepte. Theorien. Impulse. (Planung neu denken | Bd. 1). Dortmund: Verlag Dorothea Rohn.
Kobbe, Ulrich (2010): Hilfe! Experten des Infamen… Eine ganz alltägliche Text-Collage. In: Psychologie und Gesellschaftskritik, 34(4), 73-84. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-388516, Zugriff am 11.03.2022.
Kuhn, Thomas S. (1973): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Frankfurt: Suhrkamp.
Lewin, Kurt (1946): Action Research and Minority Problems. In: In G. W. Lewin (Hg.), Resolving social conflicts. New York: Harper & Row.
Libbe, Jens und Marg, Oskar (2021): Urbane Reallabore und Stadtentwicklung. Erfahrungen und Perspektiven für Forschung und Praxis urbaner Transformation, Synthese Paper* Nr. 3, Berlin. https://www.nachhaltige-zukunftsstadt.de/downloads/SynVerZ_Synthesebericht_Reallabore.pdf, Zugriff am 11.03.2022.
Mackert, Jürgen und Steinbicker, Jochen (2013): Zur Aktualität von Robert K. Merton. Wiesbaden: VS Verlag.
Merton, Robert K. (1973): The Normative Structure of Science. In: The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations, S. 267–278.
Merton, Robert K. (1980): Auf den Schultern von Riesen. Ein Leitfaden durch das Labyrinth der Gelehrsamkeit. 2. Auflage. Frankfurt: Syndikat.
Merton, Robert K. (1993): The Post-Italianate Edition. On the Shoulders of Giants. A Shandean Postscript. Chicago/London: University of Chicago Press.
MHKBG NRW (Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen) (o. J.): Regionale Zusammenarbeit. https://www.mhkbg.nrw/themen/bau/land-und-stadt-foerdern/regionale-zusammenarbeit, Zugriff am 11.03.2022.
MWK (Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg) (o.J.): Baden-Württemberg fördert Reallabore, https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/forschung/forschungspolitik/wissenschaft-fuer-nachhaltigkeit/reallabore/, Zugriff am 11.03.2022.
Narr, Wolf-Dieter und Offe, Claus (1976): Was heißt hier Strukturpolitik? In: Technologie und Politik Bd. 6. Reinbek: Rowohlt.
Nohrden, Dörte (2019): Wie aus Bürgern Wissenschaftler werden, https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/citizen-science-die-buergerwissenschaftler-a-1254092.html, Zugriff am 11.03.2022.
Nowotny, Helga; Scott, Peter B. und Gibbons, Michael T. (2003): ›Mode 2‹ Revisited: The New Production of Knowledge. In: Minerva 41. Jg, 179–194.
Rall, Philipp (2019): Diese 5 Science-Apps machen dein Handy zum Labor, https://www.futurezone.de/apps/article226293579/diese-5-science-apps-machen-dein-handy-zum-labor.html, Zugriff am 11.03.2022.
Schneidewind, Uwe (2014): Urbane Reallabore – ein Blick in die aktuelle Forschungswerkstatt . In: pnd | online III | 2014: 19–25. https://epub.wupperinst.org/frontdoor/deliver/index/docId/5706/file/5706_Schneidewind.pdf, Zugriff am 11.03.2022.
Schneidewind, Uwe (2020): Die Stadt als Reallabor – Fünf Thesen zur Rolle der Wissenschaft in urbanen Transformationsprozessen In: Ulrike Gerhard, Editha Marquardt (Hg.): Die Stadt von morgen. Heidelberg: Heidelberg University Publishing. DOI: https://doi.org/10.17885/heiup.studg.2020.2.24133, Zugriff am 11.03.2022.
Selle, Klaus (2018): Alle im Blick? Kommunikative Interdependenzgestaltung in Prozessen der Stadtentwicklung. Eine Geschichte der Entdeckungen. In: Ders.: Stadt entwickeln. Lemgo: Verlag Dorothea Rohn. 387-437.
Storz, Friederike und Auer, Barbara (2019): Macht schlau: Spannende Projekte für „Bürgerforscher“. https://www.aktiv-online.de/ratgeber/macht-schlau-spannende-projekte-fuer-buergerforscher-3495, Zugriff am 11.03.2022.
Universität für Bodenkultur Wien (o. J.): Tea Bag Index, https://www.citizen-science.at/projekte/tea-bag-index, Zugriff am 11.03.2022.
Von Unger, Hella (2014): Partizipative Forschung, Einführung in die Forschungspraxis. Wiesbaden: VS Verlag.
Wikimedia Commons (o. J.): File:Library of Congress, Rosenwald 4, Bl. 5r.jpg, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Library_of_Congress,_Rosenwald_4,_Bl._5r.jpg, Zugriff am 11.03.2022.
Wiktionary (o. J.): forschen. https://de.wiktionary.org/wiki/forschen, Zugriff am 11.03.2022.
Winter, Mona; Ochmann, Nana und Vogel, Angela (1987): Venusfliegenfalle. Sozialarbeit – Geometrisierung der Nächstenliebe. Frankfurt: Syndikat.
Wissenschaft im Dialog gGmbH (o. J.): Projekte entdecken. https://www.buergerschaffenwissen.de/projekte, Zugriff am 14.03.2022.
Ziems, Tilla und Schnur, Olaf (2019): Auf Augenhöhe: Basics partizipativer Forschung. Literatur-Review und eine Verortung des vhw. In: vhw werkSTADT H.33. Berlin.
Zlonicky, Marlene und Zlonicky, Peter (1974): Plädoyer gegen Planung als Wissenschaft. In: Bauwelt H. 38/ 1974.
Eine um Quellenkommentare und weiterführende Hinweise ergänzte Fassung dieses Textes ist zu finden auf: https://netzwerk-stadt.eu